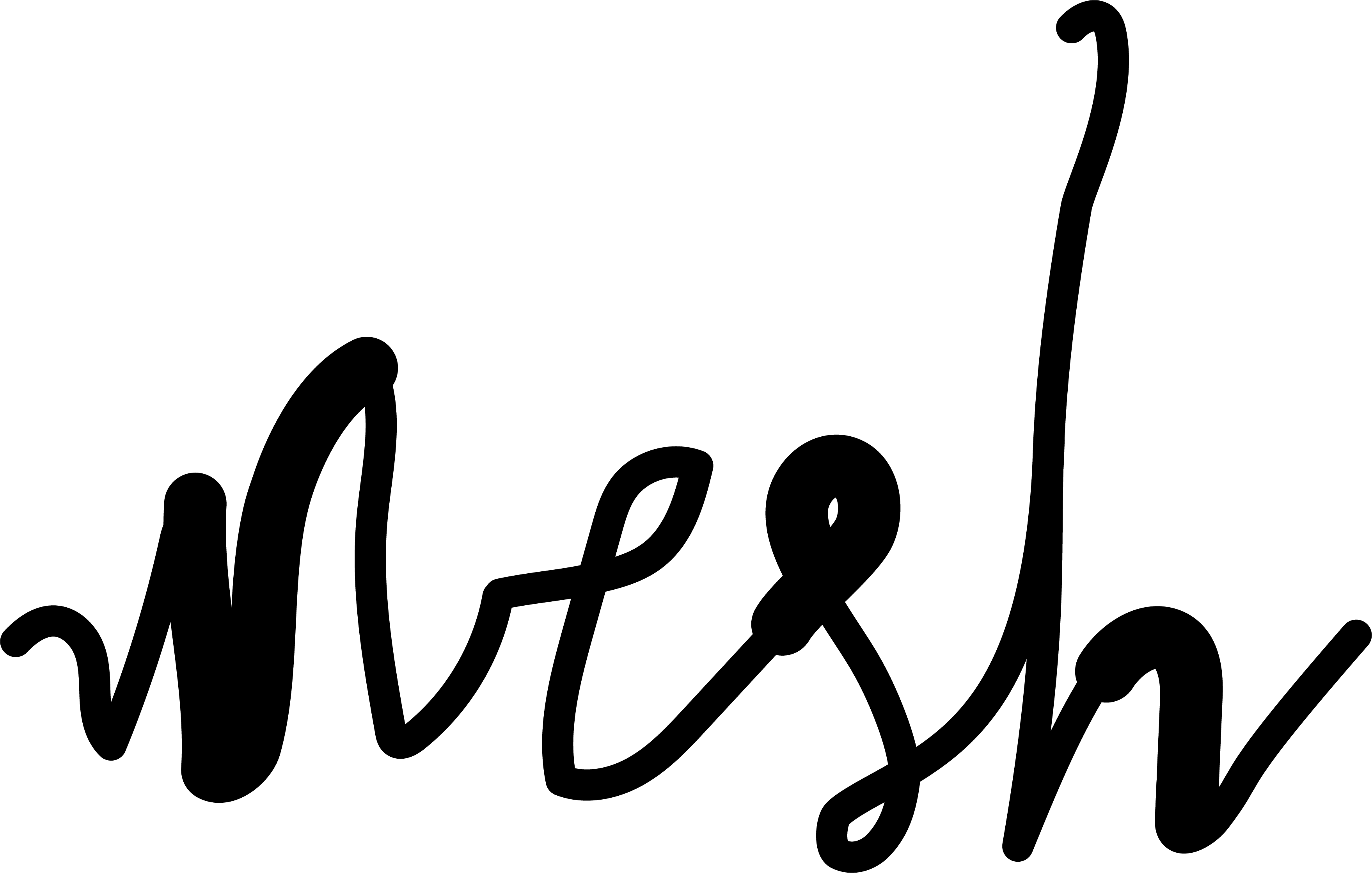Ich treibe mich herum, schlafe mit Frauen und Männern, ich liebe es, verschiedene Körper kennenzulernen, mit meinen zu Krallen gefeilten Fingernägeln über die Haut eines Anderen zu gleiten, die Schwelle zum Kratzen nie zu überschreiten, aber stetig eine Verwundung in Kauf zu nehmen. Mein Fell schimmert im Sonnenlicht, es ist seidig, glatt und schwarz. Meine Schnurrhaare kitzeln deine Wangen. Mit meinem Kopf reibe ich an deinen Beinen, die Waden suche ich ab mit meiner herzförmigen Nase, meine zarten Ohren knicken ein, wenn ich von unten nach oben streife. Meine Tatzen bewegen sich rhythmisch auf deiner Brust. Vielleicht ist es der Milchtritt, diesen wenden die kleinen Katzen an, wenn sie Milch aus den Zitzen der Mutterkatze saugen. Vielleicht wurde ich zu früh von meiner Mutter getrennt, vielleicht bin ich nervös, auf der Hut, vielleicht will ich mich selbst beruhigen, oder dich, damit du mir nichts antust. Aus meinen Augen, meiner Mitte, meinen Poren strömt unablässig mein Wasser. All meine Körperflüssigkeiten verbinden sich zu einem Bach, zu einem Fluss, zu einem Strom. Dieser umspült mich und trägt mich fort. Mein Wasser und ich werden zu einem See. Ich bin kein abgründiges Loch, ich bin ein flacher See, du musst lange in mich hinein waten, willst du den Boden unter deinen Füßen verlieren. Erst spät werde ich so tief, dass du schwimmen musst, um überwasser zu bleiben. Mein Wasser schimmert heute so grau wie der Himmel. Es leben Stichlinge in der Nähe meines Ufers, sie kitzeln deine Füße, wenn du in mich trittst. Algen haben sich gebildet, doch an ihnen vorbei kannst du auf meinen Grund sehen. Mein Wasser ist klar und still. Die Winter, in denen ich zu Eis wurde, sind lange her. Nur noch dunkel erinnere ich mich an die Kinder auf Schlittschuhen, die auf mir Kreise zogen. Du warst auch dabei. Einmal bist du durch die dünne Eisdecke auf meiner Wasseroberfläche gebrochen und in mich gefallen, eiskalt war ich und so auch du. Im Sommer sprangst du in mich hinein, du bist erst weit hinaus auf einen Steg gelaufen, damit du meine tiefen Stellen erreichst. Getaucht bist du, an einer Muschel hast du dir die Haut des mittleren Fingerknöchels aufgeschnitten. Eine Narbe sieht man bis heute. Lange hast du mich nicht besucht, seit geraumer Zeit habe ich dich nicht in mir gespürt. Laut wird es im Sommer und im Winter ist es still. Der Wind fegt über mich hinweg und wühlt mich auf. Ich bin ein Teil von dir. Kein Berg, kein Meer, kein Feld füllt die Stelle in dir aus, die ich präge. Wenn du in dich hineinhorchst, hörst du mein Plätschern. Meine Familie ist unglücklich, wie so viele andere auch. Da wir unglücklich sind, sind wir interessant. Ich habe meine Eltern kennengelernt, da liebten sie sich noch. Sie kommen aus einer anderen Zeit. Mein Vater kennt seine Gefühle nicht, hat keine Worte und keine Gesten für Liebe, Angst, Trauer. Er hat beschlossen, auf der anderen Seite der Emotionen zu leben. Leiden tun die anderen, wir haben doch alles. Meine Mutter hat gelernt, sich zu kümmern. Sie macht mir Essen, bringt mich zur Schule und ins Bett. Sie fragt, wie es mir geht und achtet darauf, dass ich warm genug gekleidet bin. Ich habe die Freiheit, mich nicht anzupassen. Ich will nicht trinken und nicht rauchen und nicht die richtige Musik hören und nicht die richtige Marke tragen. Ich genieße es, anders zu sein und herauszufallen. Mir kommt die Welt, wie sie ist und wie die anderen sagen: zu sein hat, falsch vor. Warum mich einpflegen in Systeme, die ich ablehne. Außenseiter sein ist meine Auszeichnung, mein Erfolg. Die Blicke und Kommentare der Anderen halte ich nicht nur aus, sie sind die Zeichen, dass ich das Richtige tue. Ich spiele im Dickicht, mit meiner kleinen Schwester krieche ich auf Unterarmen durch den Garten. Wir sind GSG9 Kämpfer. Ich spiele Instrumente, die niemand kennt. Als ich mit meinem Vater ein Loch aushebe um einen Baum zu pflanzen, finde ich den Kirchenschatz in unserem Garten, der dort vor den Russen versteckt wurde, als diese das Land übernommen hatten. Ich klettere auf Bäume und sammele Steine, bin halb Affe und halb Mensch. Wenn ich Liebeskummer habe, verliere ich mich in digitale Welten. Ich verteidige Territorien und kämpfte gegen die Bösen. Es macht mir nichts aus, alles abzuknallen, was nicht da sein sollte. Ich gehe raus, während meine kleine Schwester zuhört und von meiner Mutter lernt, sich zu kümmern. An mich wird geglaubt, ich entdecke die Welt und meinen Körper. Ich sitze mit meinen Jungs in einem abgedunkelten Zimmer, die Fenster sind geschlossen, es gibt kaum Sauerstoff im Raum, aber wir können nicht lüften, es würde uns verraten. Wir leben in einer Stadt, in der die Polizei wenig zu erledigen hat und sich mit großer Genugtuung auf die kiffende Jungend stürzt. Auf die Wand vor uns projizieren wir YouTube Videos, aus einer Box kommt uns das DJ Set vom letzten Wochenende entgegen. Meine Jungs gehen sprühen, sie malen Züge und klettern auf Baugerüste und Bierkästen, es gibt eine Karte, in der die möglichen neuen Spots verzeichnet werden. Wir gehen mit offenen Augen durch die Straßen und freuen uns, wenn wir ein Bild von einem unserer Homies entdecken oder eine Stelle auf einer guten Wand, die noch nicht gemalt wurde. Sie sprechen in einer Fachsprache. Die Worte, die sie nutzen, musste ich lernen wie Vokabeln. Doch jetzt bin ich mitten unter ihnen. Ein Fisch geborgen im sicheren Schwarm. Niemand muss allein raus, wir bilden eine sich organisch transformierende Ansammlung kleiner Einzelteile. Wir sind furchteinflößend, unzerbrechlich. Ich stehe an der Bushaltestelle im Niemandsland. Brandenburg, nichts als Bäume und Felder und leere Straßen. Ich bin abgehauen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis es jemandem auffällt. Die Betreuenden aus dem Heim haben genug mit den anderen Kindern zu tun. Irgendwer tanzt immer aus der Reihe, ruhig ist es nie. In unbekannter Umgebung stehe ich schüchtern in Ecken und schaue mit großen, ängstlichen Augen nach oben. Jede Faser meines Körpers ist angespannt, darauf gefasst, mich wegzuducken oder mir eine Lücke zu suchen, in der ich verschwinden kann. In vertrauter Umgebung hingegen bin ich laut und wild, nicht zu bändigen, ich fluche und schreie und wirbele herum. Ich mache kaputt, was ich in die Finger bekomme und respektiere niemanden. Bis sich einer der Betreuer nähert, mich blitzschnell packt und zu Boden drückt, in der Hand meinen Arm, auf meinem Rücken das erwachsene Knie. Ich schreie und zappele noch lauter, habe aber keine Chance gegen den Mann. Ich werde in einen Raum gebracht, der leer ist und dunkel. Die Tür wird geschlossen, meine Rufe kommen nur noch gedämpft zu den Anderen herüber, irgendwann gebe ich auf und es wird still.
Ich bin groß und dünn und habe Drogenprobleme und Akne. Meine Hosen sind weit und hängen so tief, dass du meine karierten Boxershorts siehst, sobald mein zu großes T-Shirt hochrutscht. Ich höre Aggro Berlin, mein Körper ist schwer und mein Kopf leer. Durch meine Adern pulsiert die Wut. Wut auf meine Eltern, die nie mit mir zurechtkamen, auf die Schulen, die dummen Lehrer, die Einrichtungen. Ich sehe keinen Platz für mich in der Welt und habe auch gar keinen Bock mehr. Mir ist alles egal, mir ist alles zuwider, ich hasse das, wo ich herkomme, ich hasse das, wo ich bin, ich hasse das, was auf mich wartet. Ich hasse mich selbst und alle anderen noch viel mehr. Ich sehe keinen Grund, mich anzustrengen, für welche Zukunft, es juckt mich einen Scheiß, ob ich den Hauptschulabschuss schaffe, soll meine Lehrerin so laut brüllen wie sie will. Ich will rauchen und Mucke hören und nicht mehr aufstehen. Wofür. Seit ich klein war, wurde mir und den anderen gesagt, dass wir Dreck sind und zu nichts zu gebrauchen, dass wir keinen Wert haben und die Welt uns nichts schenken wird. Ich bin nicht dumm, aber es gibt auch keinen Grund, irgendwem das Gegenteil zu beweisen. Sollen die Alten doch denken, was sie wollen. Sollen sie Maßnahmen ergreifen und Verbote und Ziele aussprechen. Sollen sie mich anschreien, wegsperren, reizen, alles prallt an mir ab. Hinter der Mauer aus Coolness gibt es noch eine dünne Schicht Luft, nur hier kann ich atmen. Ich bin in den Westen gefahren und trage Schuhe mit hohen Absätzen. Ich beobachte den Galeristen, wie er angeregt mit einer Frau spricht, deren große, gelbe Wildlederhandtasche neben ihr auf dem Boden liegt. Sie ist leicht geöffnet, ich kann ein etwa 20 Zentimeter großes Portemonnaie erkennen, von einer edlen Marke, genau wie die Tasche. Ein in Leder gebundener Kalender, das neueste iPhone. Die Frau steht neben meinem Freund, der kurz das Gleichgewicht verliert und plötzlich mit einem Fuß in die geöffnete Handtasche steigt. Niemand bemerkt den Fehltritt, sie sind alle mit den richtigen Leuten und Networken beschäftigt. Sie spiegeln gegenseitig ihre Bewegungen, warten auf den richtigen Moment um das Richtige zu sagen, sie monologisieren paarweises, sie sind Profis der Kommunikation.
Ich gebe ein Knacken von mir. Gekleidet in einem weißem Hemd stehe ich hinter der Bar, meine linke Hand steckt in einem Handschuh aus verknüpften Metallringen. Ich muss an die Kettenhemden der Ritterverkleidung meines Bruders denken, der früher gern mit unserem Vater auf Mittelaltermärkte fuhr. Auf meinem Kettenhemdhandschuh liegt eine gerade aufgespaltene Auster. Ich zerdrücke eine Zitronenspalte über der glibberigen weißen Fleischmasse und erkläre stolz, dass die Tiere so frisch sind, dass sie noch leben, wenn ich sie aus der Holzkiste hole. Du erkennst es an dem Zucken, wenn die Säure der Zitrone auf das Muschelfleisch trifft. Ich reiche die soeben geöffnete, beträufelte, getötete Auster einem der Männer in Anzug vor der Bar. Dieser hat bereits eine hauchdünne Scheibe Pumpernickel mit Butter beschmiert und schlürft nun das nach Algen riechende Muscheltier aus seiner panzerartigen Schale, schluckt, beißt vom Pumpernickel ab und spült mit Champagner nach. Die Stimmung ist ausgelassen, die Egos werden größer, alle sind auf der Suche nach Geltung und neuen Angeboten. Wir feiern uns selbst und vergessen, was außerhalb geschieht. Hier drinnen geht es nicht um Krieg oder Krankheit, die Armut haben wir vor der Tür gelassen, schmutzig sind die anderen. Meine Zimmerwände sind mit Postern tapeziert, darauf Fuchs und Schimmel und Friese und Shetland und Haflinger und Andalusier und Kaltblut. Ich habe ein kleines Hufeisen, ich springe und galoppiere und trabe und schreite. Ich hänge am Hals eines großen Pferdes. Ich stehe vor dem Pferd und spüre den Atem und schaue in traurige Augen. Ich liege Bauch an Rücken auf dem Pferd und lasse Arme und Beine herabhängen. Ich inhaliere den Geruch nach Heu und Staub und Stall. Ich streiche mit einer metallenen Bürste über das Fell des Pferdes, in Wuchsrichtung. Ich stehe neben dem Pferd und hinter dem Pferd und drücke mit der Schulter an seine Gelenke, damit es das Bein hebt und ich den Fuß nehmen und den Huf von getrocknetem Schlamm und Steinen befreien kann. Ich kämme seine Mähne und seinen Schweif. Ich fahre mit den Fingerspitzen vorsichtig über seine Augeninnenseiten, um den Schlaf abzuwischen. Ich setze ihm eine kleine gehäkelte Kappe auf den Kopf, ziehe sie über die Ohren. An seiner Stirn hängen jetzt Fransen herab. Wenn es sich bewegt, tanzen die Fransen und vertreiben die Fliegen. Mit meiner flachen Hand gebe ich ihm Möhre, Apfel und Hafer. Sein Maul nähert sich schnell, es malmt mit großen schiefen Zähnen, seine Nüstern blähen sich. Ich habe keine Angst vor Kitsch und Klischee, ich trage T-Shirts mit Pferd im Sonnenuntergang, mit Pferd im Sprung, mit Pferd fliegend durch Berglandschaft. Die Filme in meinem Regal tragen Namen wie: Ostwind, Black Beauty, Dreamer und Pferdeflüsterer. Ich trage mein Haar lang und geflochten, meine Schenkel sind fest.
back to top